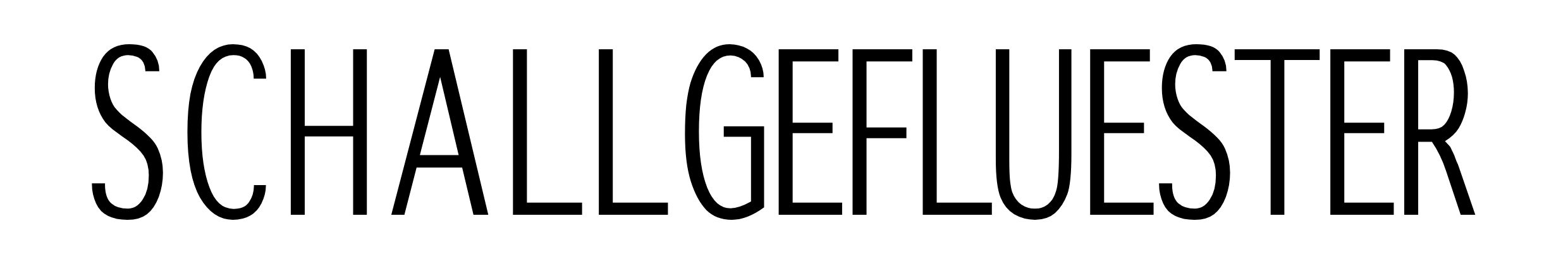[dropcap]V[/dropcap]or wenigen Tagen wurde ich während eines Konzertbesuchs wieder einmal mit einer Aussage konfrontiert, die mich innerlich zum Kochen brachte. Gästeliste hier, „ich zahl ja wenigstens was dafür“ da. Grund genug, euch einmal zu erzählen, wieso ihr nicht neidisch darauf sein solltet, wenn ich kostenlos auf Konzerte gehe.

Auf dem Soundgarden Festival 2016 | Foto: Michael Hauler
Es gibt eine Sache, die höre ich seit den Anfängen als Musikbloggerin nur allzu oft: Viele Menschen beneiden mich darum, dass ich die meisten Konzerte kostenlos besuchen darf. Ja, ich zahle in den allerseltensten Fällen Eintritt und nutze diesen Vorteil zum Großteil natürlich auf Veranstaltungen, die meinem persönlichen Interessengebiet entsprechen.
Aber glaubt mir – so schön die Konzerterlebnisse an sich auch sein mögen, die wenigsten Leute unter euch würden vermutlich mit mir tauschen wollen.
Ihr kauft euch ein Ticket und erlebt dann einen Abend völlig ohne Verpflichtungen. Ihr könnt mittanzen, mitsingen und pogen wie es euch beliebt.
Ich hingegen fahre oft stundenlang zu diversen Konzerten und muss dabei immer auf super viele Kleinigkeiten achten und super viele Leute gleichzeitig zufriedenstellen.
Zu Beginn der üblichen Konzertsituation nehme ich mir nur selten Sonderrechte raus. Ich mische mich in der Regel wie jede(r) Andere auch unter das Publikum und kämpfe um eine möglichst gute Sicht – nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich dann oft nur diese berühmten (zwei bis) drei Songs lang dafür Zeit habe, die perfekte Situation im perfekten Licht aus der perfekten Perspektive festzuhalten und dabei den Konzertgenuss der zahlenden Menschen möglichst wenig zu behindern. Ist auch mal ein Bühnengraben vorhanden, dann mag ich zu Beginn vielleicht vor allen anderen Leuten stehen und einigermaßen frei drauf losknipsen, habe aber für den Rest des Konzerts mehr oder weniger die A*karte gezogen. Denn mit wahnsinnig teurem und empfindlichem Equipment irgendwo am Rande eines Konzerts zu stehen, macht ganz oft nur halb so viel Spaß wie die unbeschwerte Bewegungsfreiheit als stinknormale(r) KonzertbesucherIn.
Entgegen der landläufigen Meinung trifft man im Graben oder drumherum zumeist die selben Leute, zum Teil entwickeln sich auch gute Freundschaften unter FotografInnen. Es gibt aber auch zu ein paarmal im Jahr Spezialfälle, die einem aus dem Nichts Sprüche wie „hab gehört, hier darf jeder fotografieren“ und „Frauen schlafen sich eh nur hoch“ drücken oder einem anders ihre pure Überheblichkeit und Verachtung zum Ausdruck bringen. Uff, jetzt bloß nicht ausrasten, sonst ist man eh nur die Zicke…
Auch nicht so cool: Wenn man das Konzert nicht direkt komplett verlassen muss, büßt man durch Abgabe der Kamera oder entsprechende Absprachen gut und gern auch mal eine tolle Sicht und Akustik ein. So geschehen etwa während des Mark Forster Open Airs in Dortmund, auf dem ich während eines meiner Lieblingssongs laut mitsingend aus der dritten Reihe nach weiter hinten verschwand und mir von da aus mal strahlend und mal heulend Gedanken darüber machen musste, wie ich diesen Abend im Anschluss in ein paar lesenswerte Worte packen könnte.

Auf dem Mark Forster TAPE Open Air Dortmund | Foto: KK
Während ihr euch am Ende eines üblichen Konzerts des tollen Tages/Abends erfreut, geht die Arbeit bei mir erst so richtig los. Wenn ich nicht schon vor Ort damit begonnen habe, dann werden spätestens auf der Rückfahrt die ersten Fotos aussortiert, die übrig gebliebenen oftmals mehreren hundert Schüsse mit Ankunft in der nächtlichen Bleibe auf den lahmen Laptop gezogen und einer ersten Sichtung unterzogen. Im Zuge dessen entsteht auch in der selben Nacht noch das mittlerweile traditionelle Posting des „Ersten Eindrucks“, sofern mir auch tatsächlich die entsprechende Technik zur Verfügung steht.
In einigen Fällen bin ich eh noch aufgekratzt genug und starte direkt mit der tiefergehenden Bearbeitung. War das Konzert allerdings wie so oft mal nicht direkt um die Ecke, lege ich mich an dieser Stelle aufs Ohr, um möglichst früh meinen durchschnittlich zwei bis vier Stunden langen Heimweg mit der Bahn anzutreten.
Irgendwann ist es dann endlich soweit und ich tauche so richtig in meine eigene Welt ein. Die meiste Zeit über bin ich auf die Bearbeitung der Bilder so fixiert, dass ich über den gesamten Tag hinweg sämtliche andere Lebensinhalte so klein wie möglich halte und sogar das Essen und Trinken vergesse. Sicher könnte ich die Fotos auch völlig roh in die Welt hinaus ballern oder die Bearbeitung komplett vereinheitlichen, doch was bringt es mir, nicht das meiner Ansicht nach Beste aus den Bildern herauszuholen?
Besonders krasser Druck herrscht genau dann, wenn KünstlerInnen auf Impressionen warten. In solchen Situationen kommt es gut und gern auch vier- bis fünfmal (und manchmal noch öfter) am Tag vor, dass mir das Programm abstürzt und ich die Bearbeitung einzelner Fotos noch einmal von vorn starten kann. Und so lasse ich mich zum Teil tagelang nirgendwo mehr blicken.
Wenn’s gut läuft, kann ich die Fotos für diesen Aufwand doch verhältnismäßig schnell in die Welt hinaus posten; wenn es schlechter läuft, dann funken noch allgemeines Privatleben, Uni und Arbeit dazwischen. Denn von irgendetwas muss ich ja auch leben. Verrückte Vorstellung, oder?
 Beim Big Day Out | Foto: Sophie Kordes |
 Bei Bochum Total | Foto: Thomas Adamczyk |
Sind die Fotos endlich mal allesamt bearbeitet, verkleinert mit Watermarks versehen, erneut aussortiert – meistens schaffen es pro Band so zwischen 30 und 120 in die engere Auswahl – werden sie je nach momentanem Geisteszustand mal mit kleinerem und mal mit größerem Text versehen.
Und dann kann es ganz unterschiedlich weiter gehen:
Im Optimalfall werden meine Impressionen recht schnell von den entsprechenden MusikerInnen entdeckt und weiterverbreitet. Damit helfen wir uns dann gegenseitig: Die KünstlerInnen haben Bildmaterial und ich bekomme bestenfalls mehr Aufmerksamkeit für meine Arbeit und kann dadurch in Zukunft mehr in dieser Richtung machen.
Damit einhergehend liebe ich das positive Feedback der abgelichteten MusikerInnen. Als besonders dankbare Beispiele mag ich da etwa Love A, Schreng Schreng & La La, Illegale Farben, KAFVKA, Jennifer Gegenläufer, Into The Fray, An Early Cascade und Marathonmann nennen. Ihr seid pures Gold, wisst Ihr das?
So läuft das aber lange nicht bei allen. Ganz oft interessieren sich die MusikerInnen unabhängig von jeglicher Bildqualität nicht die Bohne für die Fotos einer kleinen (verhältnismäßig eher unbedeutenden) Fotografin und Bloggerin.
Doch selbst in so einem Fall gibt es immer noch zwei Szenarien: Im Best Case schart sich zumindest eine starke Fangemeinde um besagte MusikerInnen und pusht meine Inhalte so stark wie nur möglich. In der Realität ist mir das bisher mit zwei Fangruppen passiert: Jenen von GLORIA/Klaas Heufer-Umlauf und Mark Forster. Besonders auf Twitter und Instagram werde ich von den entsprechenden Fans mit wundervollen Lovestorms überschüttet. Das ist Balsam für meine Seele.
Deutlich öfter ereignet sich das dazugehörige Worst Case Szenario. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, wie oft es mir vorgekommen ist dass mich MusikerInnen nach meinen Fotos fragten, ich dafür alles stehen und liegen ließ und danach nie wieder ein Wort darüber verloren wurde.
Und worauf ich definitiv auch verzichten könnte, ist Bilderklau ohne jegliche Form von Credits. Die meisten FotografInnen können ein Lied davon singen. Und Hand auf Herz: Ich gehöre zu denjenigen, die sich entsprechende MusikerInnennamen (auch in Fällen befreundeter FotografInnen) so gut wie nur möglich merken und aus den uneinsichtigen Fällen ihre Konsequenzen ziehen.
In jedem der möglichen Worst Cases muss und will ich tief durchatmen und einfach weiter machen: Trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund fetter Reichweiteneinschnitte – etwa seitens Facebook – freue ich mich ungelogen über jeden Like und jedes einzelne liebe Wort. Denn während MusikerInnen und klassische InfluencerInnen stets eine ähnliche Zielgruppe bedienen und diese daher deutlich bessere Chancen haben, konstant zu wachsen, muss ich durch meine Vielfältigkeit immer wieder darauf aufpassen, niemanden durch „uninteressanten Content“ zu verschrecken. Ein Spagat ohnegleichen.

Auf dem Soundgarden Festival 2016 | Foto: Nicole/Music-Event-Reports
Wieso ich das alles überhaupt mache, wenn es doch so anstrengend ist, fragt ihr euch? Weil ich es verdammt nochmal liebe. Ich liebe das, was Musik mit mir macht. Ich liebe es, wenn ich talentierten Menschen ein Stück weit helfen kann. Ich liebe die Atmosphäre auf Konzerten, das Loslassen und die stets neuen Licht-, Performance- und Publikumssituationen. Ich liebe es, meine Fähigkeiten von Konzert zu Konzert weiter zu entwickeln und tolle Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Und ich möchte nicht, dass ihr die kostbare Zeit auf den Konzerten mit Blick auf eure Smartphonebildschirme an euch vorbeiziehen lasst.
Übrigens: Auch wenn ich mich nicht selten am Ende des Monats von trockenen Nudeln aus dem Vorratsschrank ernähren muss, fließt mein meistes Geld neben der Miete, dem mobilen Internet und dem Abo für Photoshop in Merchandisingartikel und Tickets für Veranstaltungen wie Poetry Slams oder Live-Podcasts.